|
|
|
2.2.1 Nativer Datenbankzugriff
Als Standardabfragesprache für relationale Datenbank-Managementsysteme hat sich heute SQL etabliert, wobei die meisten DBMS-Hersteller dieses ANSI-SQL für Ihre Produkte um spezifische Funktionen erweitert haben.
Für die Entwicklung von Client/Server-Anwendungen haben alle Hersteller eigene, proprietäre Programmierschnittstellen und DBMS-Protokolle (für den Datenaustausch zwischen Client-Applikation und Datenbank-Server) entwickelt, so daß ein Web-Datenbank-Gateway für den nativen Zugriff auf das DBMS, d.h. unter Benutzung der DBMS-spezifischen API, an jedes Produkt, welches benutzt werden soll, individuell angepaßt werden muß.
Vorteile
Nachteile
2.2.2 ODBC - Open Database Connectivity
ODBC ist ein offener, Hersteller-unabhängiger Standard für den API-Zugriff auf Datenbank-Managementsysteme. Er wurde von Microsoft in Zusammenarbeit mit der SQL Access Group (SAG), X/Open und weiteren Softwareherstellern entwickelt und bietet eine auf ANSI-Standards basierende SQL-Sprache an.
Eine Applikation, die ihre Datenbankzugriffe auf Grundlage der ODBC-API realisiert, kann über DBMS-spezifische ODBC-Treiber mit verschiedensten Datenquellen - auch parallel - zusammenarbeiten. Außerdem wird ein Treiber-Manager benötigt, der zwischen Applikation und Treiber sitzt. Auf Windows-Plattformen sind Treiber und Manger als dynamik-link libraries (DLLs) implementiert. Abbildung 10 zeigt die ODBC-Architektur im Überblick.
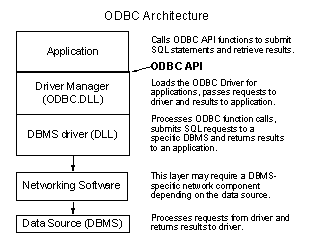
Abbildung 10: Die ODBC-Architektur
In [W9] werden unterschiedliche (auch Multiple-Tier) Treiberarchitekturen vorgestellt, wodurch ODBC-fähige Web-Datenbank-Gateways mit einer solchen Treiber-Architektur ohne zusätzliche Programmierung auch mit auf unterschiedlichen Hosts verteilten Datenbanken arbeiten können.
Vorteile
Nachteile
2.2.3 JDBC - Java Database Connectivity
JDBC ist, ähnlich wie ODBC, eine Schnittstellendefinition für die Produktunabhängige Kommunikation von Anwendungen mit Datenbanken, allerdings für die Programmiersprache Java. Auf Java wurde in Abschnitt 2.1.7 bereits ausführlicher eingegangen.
JDBC wird von Sun in Koordination mit allen namhaften Datenbankherstellern entwickelt und ist seit der Version 1.1 des Java Development Kit als fester Bestandteil in Java integriert (vgl. [W13]).
Die Programmierschnittstelle definiert Java-Klassen für Datenbankverbindungen, SQL-Befehle, Ergebnismengen, Datenbank-Metadaten usw. und ermöglicht so dem Programmierer das Abschicken von SQL-Statements und die Verarbeitung der Ergebnisdaten.
Implementiert ist das JDBC-API mittels eines Treibermanagers, der mehrere Datenbanktreiber unterstützt. Die wiederum können verschiedene Datenbanksysteme ansprechen. JDBC-Treiber können komplett in Java geschrieben werden, so daß sie als Teil eines Java-Applets über das Web runtergeladen werden können, oder aber mittels nativer Methoden auf existierende Datenbankzugriffsbibliotheken zurückgreifen.
Für Treibertypen, die nativen Code benötigen, muß dieser für jeden Web-Client separat geladen und installiert werden. Deshalb halte ich den Einsatz solcher Treiber nur auf Serverseite für sinnvoll, z.B. für einen in Java programmierten Applikationsserver in einer Three-Tier-Architektur, oder begrenzt für Intranetanwendungen in homogenen Umgebungen.
Es gibt vier Kategorien von JDBC-Treibern ([W13], jdbc.drivers.html):
Sofern Java die Programmiersprache der Wahl ist, ist es sicher naheliegend, auf die JDBC-API zurückzugreifen, wobei auch hier wie bei ODBC anhand der geplanten Anwendung zwischen Kompatibilität und Performance abgewogen werden muß.